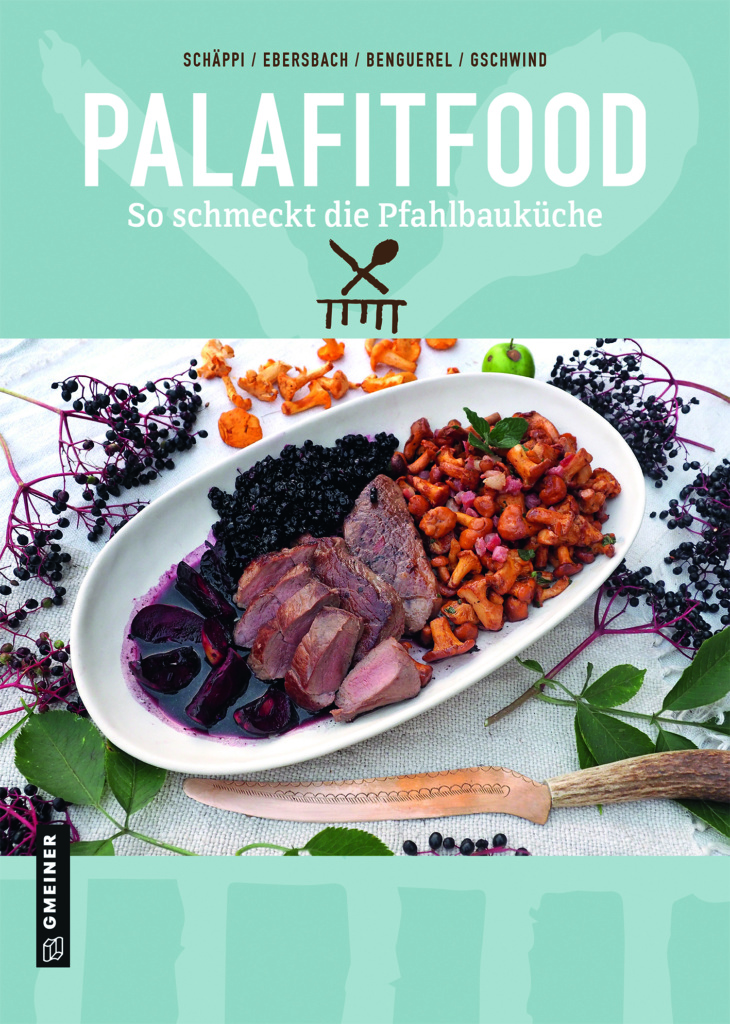In puncto Schärfe ist eine frisch geschlagene Feuersteinklinge (Silex) kaum zu übertreffen. Doch die ab 2200 v. Chr. neu eingeführte Bronze läuft dem Stein den Rang ab. Sie lässt sich in fast jede beliebige Form bringen, kann x-mal geschärft werden, ist recycelbar und sieht mit ihrer rotgolden glänzenden Oberfläche erst noch schön aus.
Als Steine aus der Mode kamen
Unglaubliche 2,5 Millionen Jahre lang dienten Steine dem Menschen als Werkzeug. Er hat es weit gebracht damit, wurde vom Urmenschen zum Homo sapiens, jagte Tiere und zerlegte sie, machte damit Feuer, stellte mit Steinen Werkzeuge aus Holz, Knochen und Geweih her und schuf Kunstgegenstände. Mit Steinäxten fällten die Jungsteinzeitler*innen Bäume und bauten Häuser, mit Sicheln aus Silex ernteten sie Getreide. Und dann entdeckte der Mensch, dass man aus bestimmten Steinen einen neuen Rohstoff gewinnen kann: Kupfer. Wie so vieles kam auch diese Innovation aus dem Osten und gelangte in der Jungsteinzeit, im 4. Jahrtausend v. Chr., in die Pfahlbausiedlungen. Der nächste Innovationsschritt folgte 2000 Jahre später mit der Erfindung der Bronze. Die Legierung aus Kupfer und Zinn ist härter, elastischer und einfacher zu verarbeiten als Kupfer allein. Dieser neue Werkstoff läutete die Bronzezeit ein und ersetzte langsam, aber sicher die altbewährten Steinwerkzeuge.

Jahrtausende alter Glanz
Die Pfahlbaufundstellen sind bekannt für die ausserordentliche Erhaltung von organischen Materialien wie Holz, Textilien und Pflanzenresten. Weniger im Bewusstsein ist, dass auch Metall im dauerfeuchten Boden ohne Sauerstoff die Jahrtausende oft unbeschadet übersteht. Ein frisch ausgegrabenes Bronzemesser kann noch rotgolden glänzen, wie am Tag, als es sein*e Besitzer*in das letzte Mal in den Händen hatte. Und wer genau hinschaut, erkennt auf den Bronzemessern noch so manche Spur von deren Herstellung und Verwendung: Hammerschläge, Feilspuren, Kratzer oder Scharten. Man kann sich die Bronzehandwerker*innen bildhaft vorstellen, wie sie die Messerklingen Schlag für Schlag mit feinen Meisseln verziert haben.


Experimentieren geht über Studieren
Um die Spuren auf einem Bronzemesser korrekt zu interpretieren, muss man sich selbst ans Giessen, Hämmern, Schleifen und Verzieren machen und die Messer danach auf ihre Tauglichkeit testen. Die Methode dafür ist die experimentelle Archäologie. Sie beantwortet Fragen, lüftet Geheimnisse, geht Schreibtischtheorien auf den Grund und macht manchmal lang gehegte Lehrmeinungen zunichte. Mit experimenteller Archäologie machen wir uns auf die Spur des Entstehens und der Verwendung eines Pfahlbauermessers. Als Vorlage dient ein rund 3000 Jahre altes Bronzemesser aus der Fundstelle Wollishofen-Haumesser bei Zürich (CH). Zuerst hat man es genauestens untersucht, dann Hypothesen aufgestellt und diese mit mehreren Experimentserien so lange überprüft, bis die Spuren von Herstellung und Verwendung an Original und Replik exakt übereinstimmten.

Ein Grillfeuer reicht nicht
Wer hat schon Zinn gegossen, z. B. rätselhafte Formen ins Wasserglas an Silvester? Bronzegiessen ist im Vergleich dazu höhere Kunst. Kupfer schmilzt bei 1083 °C, die Zugabe von Zinn senkt den Schmelzpunkt. Dennoch reichte den Pfahlbauer*innen ein Grillfeuer bei weitem nicht, sondern sie brauchten eine Grube, gute Holzkohle, Blasebälge, Schmelztiegel und viel Übung. Erst dann konnten sie eine ausreichende Menge Metall schmelzen und in die Gussformen aus Ton oder Stein füllen. Sandstein war hierfür das bevorzugte Material. In zwei Gussformhälften ritzten die Giesser*innen das Negativ des Messers, setzten die Steinplatten passgenau mit Hilfe von Holzstiften aufeinander und banden sie zusammen. Nach dem Guss erstarrte das Metall rasch und schon konnte man den frisch gegossenen Messerrohling aus der Form nehmen. Wer jetzt glaubt, das Ziel sei fast erreicht, irrt. Die Nachbearbeitung war aufwendig, weshalb nur perfekte Rohlinge für die weitere Prozedur ausgewählt wurden. Fehlgüsse wanderten wieder in den Tiegel.


Mit Hammer und Amboss
Bronzezeitliche Schmiede würden sich die Augen reiben, wenn sie heutige Schmiede das glühende Eisen traktieren sähen. Bronze schmiedete man überwiegend kalt. Dazu dienten den Schmied*innen Hämmer und Ambosse aus Bronze und Stein. Die Bronzehämmer waren – für uns ungewohnt – mit einem geknickten Holm, einem sogenannten Knieholm geschäftet. Die Bronzeambosse jedoch hatten bereits die Form, die bis heute bewährt ist – wenn auch viel kleiner als der heutige Schmiedeamboss. Ein frisch gegossenes Messer ist weich, lässt sich verbiegen und taugt so noch nicht zum Schneiden. Erst mit gezielten Hammerschlägen verwandelt sich das Metall, wird hart, unbiegsam und die Klinge immer dünner. Das Hämmern beschränkt sich nur auf den Schneidebereich und den Griffdorn, der Messerrücken bleibt unbearbeitet.


Ohne Fleiss kein Preis
Was nun folgt, braucht Geduld, Steine, Wasser und kräftige Finger. Die Handwerker*innen entfernen jede kleine Unebenheit. Von grob zu fein, wie man es heute noch im Werkunterricht lernt. Nur dass in der Bronzezeit Steine unterschiedlicher Körnung und Härte zum Einsatz kommen. Der Preis ist der unvergleichlich rotgoldene Glanz und eine makellose, spiegelnde Oberfläche.

Das Messer ist nun bereit für den nächsten Schritt, die Verzierung. Du erinnerst dich: Man hämmert nur den Schneidenbereich, während die obere Hälfte der Klinge noch weich und formbar ist. Hier und auf dem Messerrücken reiht nun ein von geschickter Hand geführter Bronzemeissel Halbkreisbogen an Halbkreisbogen. Wer die Lupe nimmt, sieht auf dem Originalmesser fächerartig die einzelnen Meisselhiebe und erkennt, in welche Richtung der Meissel wanderte. Die Verzierung folgt dem geschwungenen Verlauf der Klinge, wie auch die Rillen, welche das leiterartige Dekor einrahmen. Auch der Rücken soll entzücken: mit schraffierten Dreiecken und einem Fischgratmotiv.

Bester Halt dank Hirschgeweih
Fehlt noch der Griff: Er besteht aus einem Stück Hirschgeweih oder Holz. Wer etwas auf sich hielt oder es sich leisten konnte, bestellte bei den Bronzegiesser*innen ein Messer mit Vollgriff, komplett aus Bronze und in gewagter Form. Aber ehrlich gesagt, der Holz- oder Geweihgriff liegt besser in der Hand. Ein geniales Material ist das Hirschgeweih: Aussen hart, innen porös. Es reicht, ein Loch in den porösen Teil zu bohren, das Geweih über Nacht in Wasser einzuweichen und den Griffdorn hineinzutreiben. Beim Trocknen zieht sich das Geweih geringfügig zusammen und die Klinge sitzt unverrückbar im Griff.

Zu guter Letzt wird das Messer scharf gemacht, mit einem feinkörnigen Schärfstein und einem Lederriemen, bis das Messer die Fingernagelprobe besteht: Die schräg auf den Daumennagel gesetzte Klinge rutscht nicht ab.
Gemüse rüsten und Fische schuppen
Und ab geht’s mit dem nagelneuen Messer in die Küche, auf das Feld, in den Wald oder zum Schlachtplatz. Mit Bronzemessern lässt sich vieles schneiden, schnippeln, hacken, schnitzen, zerteilen, trennen. Die Klingenform und Abnutzungsspuren verraten einiges über die Einsatzbereiche. Bei unserem Instagram-Post vor zwei Wochen kam die Frage von User*innen, ob denn die Messerklingen praktisch seien. Gemeint war die elegant geschwungene Form des Messers, dessen Werdegang wir eben verfolgt haben. Ja, die Messer sind praktisch und vor allem vielseitig einsetzbar. Aber zuerst müssen wir den Blickwechsel machen: Rückblickend aus heutiger Sicht ist manches, was man früher benutzte, unpraktisch oder untauglich. Wenn wir uns jedoch in die Menschen damals hineinzuversetzen versuchen, erkennen wir die Vorteile. Ein Messer hatte viele Aufgaben zu erfüllen: Gemüse rüsten, einen Stecken anspitzen, ein Tier zerlegen, Stoff zerschneiden usw. So wie das Schweizer Taschenmesser heute, das man bei sich trägt und bei Gebrauch rasch zur Hand hat, dürften die Besitzer*innen der Bronzemesser diese immer bei sich getragen haben. Je nach Einsatzgebiet kommt der vordere (Stoff zerschneiden, Tier häuten), mittlere (Gemüse rüsten, Fisch schuppen) oder der hintere (schnitzend arbeiten) Teil der Klinge zum Einsatz. Die geschweifte Form erlaubt sogar einen Wiegeschnitt beim Kräuterhacken.


Bis zum Gehtnichtmehr
Immer mit am Gürtel oder in der Tasche der Messerbesitzer*innen war wohl ein Wetzstein. War die Schneide stumpf, genügte ein kurzes Schärfen mit dem Stein. Hatte die Klinge Scharten, musste man diese jedoch mit einem Hammer ausmerzen und die Schneide begradigen. Dies geschah immer und immer wieder, bis die Messer komplett abgenutzt waren. Selbst zerbrochene Messerklingen hat man nicht ins Altmetall gegeben, sondern umgeschmiedet und mit einem neuen Griff versehen. Erst wenn gar nichts mehr zu machen war, landeten die langjährigen, treuen Helfer im Schmelztiegel – oder im See, wo wir Archäolog*innen sie heute – Jahrtausende später – wiederfinden und messerscharf analysieren.

Dieser Blog beruht auf den Ergebnissen einer unvollendeten Dissertation zur Herstellung und Verwendung spätbronzezeitlicher Bronzemesser.
Die abgebildeten Fundobjekte befinden sich im Funddepot des Nationalmuseums Schweiz.